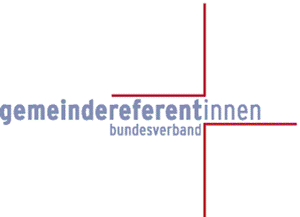„Ich entscheid‘ mich für die Liebe und für die Menschlichkeit."
von
DANIEL RUMEL, BURKHARD HOSE, ANNA-LENA PASSIOR
Stimmen gegen katholischen Rechtspopulismus
Nachdem am 10. Januar 2024 durch das Recherchezentrum Correctiv (correctiv.org) der Beitrag „Geheimplan gegen Deutschland“ veröffentlicht worden war, gab es zahlreiche Reaktionen, die zur Solidarisierung gegen Rechtspopulismus, Rechtsradikalismus oder auch für ein Verbot der AfD aufriefen. Beeindruckende und ein wenig Hoffnung weckende Demonstrationen folgten. Gleichzeitig ist die Sorge vor einem Rechtsruck in Deutschland groß, vor allem auf die Europawahl und die Landtagswahlen hin. Die Sorge ist berechtigt. Zum Plan, Millionen Menschen zu deportieren („Remigration“ verschleiert, was gemeint ist) schrieb der AfD-Bundestagsabgeordnete René Springer auf X: „Das ist kein Geheimplan, das ist ein Versprechen“.
Wie reagieren und positionieren sich Katholik*innen? Offizielle Vertreter*innen aus DBK und ZDK brachten ihr Entsetzen zum Ausdruck, viele in sozialen Medien aktive Kirchenmitglieder bezogen eindeutig Stellung gegen „rechts“. Manche davon wurden massiv attackiert, auch durch Christ*innen. Auf Facebook schrieb ein Hardcore-Katholik mit Sympathien für die Piusbrüder, dass es nur der AfD gelingen wird, zeitnah drei Millionen Menschen auszuweisen und er betont: „Ich bin für die AfD. Ich wähle sie seit Jahren, konsequent bei jeder Wahl. Es ist nur noch ein Wahnsinn! Die AfD ist meine einzige Hoffnung!“
Rechtskatholizismus ist kein neues Phänomen, schon seit Jahren gibt es Forschungen dazu. Diese zutiefst dem Evangelium widersprechende Haltung ist ein Aspekt des Themas, das uns als GR-Bundesverbands unter der Prämisse „Netzwerk gegen innerkatholischen Fundamentalismus“ beschäftigt. Seit unserem Aufruf dazu in der Ausgabe 3/2023 hat sich auf der Grundlage des Vortrags von Doris Reisinger (der in derselben Ausgabe veröffentlicht wurde) ein Netzwerk gebildet, in dem wir uns über unsere Wahrnehmungen austauschen. In Ihrem Vortrag hat Doris Reisinger Kriterien dafür benannt, wann katholischer Fundamentalismus in und für die offene Gesellschaft gefährlich wird. Ein Kriterium lautet: „Gefährlich wird es, wenn aktiv antidemokratische, homo- und frauenfeindliche Positionen vertreten, beworben und ggf. durchgesetzt werden.“ Wenn man die Szene beobachtet, stellt man fest, dass es Unterschiede gibt. Wer katholisch-traditionalistisch-lehramtstreu denkt, ist nicht automatisch AfD-Wähler*in oder rechtsradikal gesonnen. Überschneidungen gibt es jedoch sehr wohl, was man beispielsweise beim „Marsch für das Leben“ sehen kann. Beim letzten Netzwerktreffen haben sich ein paar Teilnehmende bereit erklärt, in kurzen Statements zu benennen, was sie bezüglich Rechtskatholizismus wahrnehmen, was ihnen Sorge bereitet und was sie für notwendig halten:
Drei Stimmen dazu von DANIEL RUMEL, BURKHARD HOSE und ANNA-LENA PASSIOR
Lesen Sie den vollständigen Artikel im aktuellen Magazin!
Spiritueller Missbrauch im Mittelalter?
von
Regina Nagel
Recherchen zu Elisabeth von Thüringen
Darstellungen von Elisabeth von Thüringen gibt es unzählige. Besonders frühe findet man als Reliefs mit Szenen aus ihrem Leben auf dem Reliquienschrein. Die meistgewählten Motive sind Szenen, die sie als barmherzig Zugewandte zeigen oder auch, vor allem im 19. Jh., Bilder vom Rosenwunder. Es gibt jedoch auch seltene Motive wie das, welches diesen Artikel in zwei Varianten illustriert.
Im Katalog einer umfangreichen Ausstellung zum 800. Geburtstag von Elisabeth findet man nur zweimal eine Darstellung zu einer historisch eindeutig belegten Tatsache aus dem Leben der Heiligen: Elisabeth, wie sie von ihrem Beichtvater Konrad von Marburg geschlagen wird. Eine davon ist eine Miniatur in einer Pergamenthandschrift, die um 1250/60 in Nordfrankreich erstellt wurde, die andere wurde 1895/98 als Skizze erstellt und ist hier (xxx) abgedruckt. Die Szene, auf deren Darstellung und Geschichte am Ende dieses Artikels ausführlicher Bezug genommen wird, spielt ca. 1228 in dem von Elisabeth und Konrad gegründeten Hospiz in Marburg. Elisabeth kauert am Boden, Konrad schwingt die Peitsche. Die junge Frau ist Anfang 20, Mutter von drei Kindern, seit kurzer Zeit Witwe eines der mächtigsten Fürsten ihrer Zeit. Die Burg, auf der sie lebte, hat sie verlassen. Von ihren Kindern hat sie sich getrennt als ihr klar wurde, dass ihre Entscheidung für ein Leben als „soror in saeculo“ (Schwester in der Welt) nicht mit der Sorge für die eigenen Kinder vereinbar war. Sie hat sie sehr geliebt, diese Kinder, und auch ihren Mann hatte sie geliebt. Letzteres war alles andere als selbstverständlich in einer Zeit, in der Kinder aus Machtinteressen verheiratet wurden. Ihren Beichtvater Konrad hat sie sich selbst ausgesucht, sie hat Angst vor seiner Strenge, seine Schläge (die auch ihre Dienerinnen, welche nach ihrem Tod davon berichten, treffen) schmerzen wochenlang. Ganz andere Möglichkeiten hätte sie gehabt. Nach Ungarn an den Königshof hätte sie zurückkehren können oder sich zurückziehen in ein Kloster, in dem eine ihrer Tanten Äbtissin war und Elisabeths jüngste Tochter Gertrud aufgenommen hat. Als wohltätige Witwe könnte sie in standesgemäßer Umgebung ihr Leben verbringen und dabei die Regierungsgeschäfte für ihren kleinen Sohn und Nachfolger des Landgrafen Ludwig wahrnehmen. Eine weitere Heirat wäre problemlos möglich gewesen. Ein bischöflicher Onkel hätte das gerne arrangiert. Doch schon in der Zeit als Ehefrau hatte sie ein Gelübde abgelegt, im Witwenstand nicht erneut zu heiraten und sich gehorsam ihrem Beichtvater Konrad unterzuordnen. Nach dem Tod Ludwigs entschied sie sich für ein Leben in radikaler Armut und für die Armen. Wer aus heutiger Perspektive und sensibilisiert für das vielschichtige Thema Missbrauch diese Gesamtsituation betrachtet, dem können zur Lebensgeschichte Elisabeths – wie auch bei anderen Biografien von Heiligen – Muster spiritueller Gefährdung und spirituellen Missbrauchs in den Sinn kommen. Elisabeth hatte von klein einen intensiven Bezug zu Religion und Spiritualität und fühlte sich in jungen Jahren angezogen von der neuen franziskanischen Richtung. Sie war bereit, Anweisungen geistlicher Begleiter streng zu befolgen und sie ließ sich von der Not der Menschen tiefer berühren als andere adlige Frauen ihrer Zeit. Die schlimmste Krise ihres Lebens war wohl der Tod des geliebten Ludwigs und die Entscheidung, die sie in dieser Situation trifft, ist radikaler als alles, was sie zuvor bereits getan hatte. Drei Jahre nach der Entscheidung stirbt sie mit 24 Jahren.
Aber sie wollte es doch so? Diese Frage wird heute gerne gestellt, wenn erwachsene Frauen von spirituellen Missbrauchserfahrungen im Kloster, einer geistlichen Gemeinschaft oder seitens geistlicher Begleitpersonen erzählen, und diese Frage kann einem auch bei Elisabeth in den Sinn kommen. Wer jedoch versucht, das Problem so einfach auf die Seite zu schieben, der möge sich an den Film „Gottes missbrauchte Dienerinnen“ erinnern. Aus heutiger Perspektive ist es möglich, zu sagen: Elisabeth ist eine von ihnen.
Doch: Darf man das?
Lesen Sie den vollständigen Artikel im aktuellen Magazin!